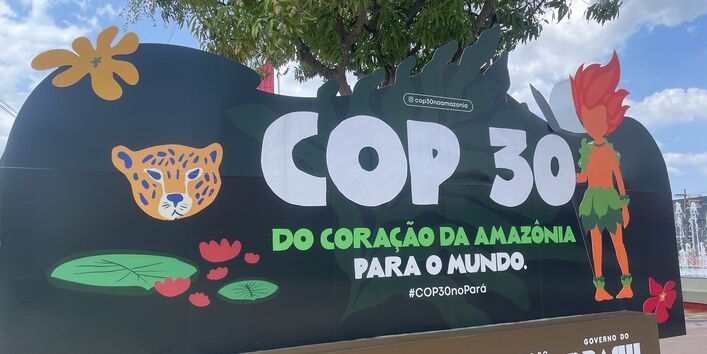Weltklimakonferenz COP30: Gemeinsam für mehr Klimaschutz
Ab 10. November 2025 – 10 Jahre nach dem Paris-Übereinkommen – verhandelt die Staatengemeinschaft erneut über die Zukunft des globalen Klimaschutzes. Diesmal am Rande des Amazonas im brasilianischen Belèm, einem symbolträchtigen Ort, der als Hotspot der Artenvielfalt und indigenen Völker gilt. Im Fokus stehen die neuen nationalen Klimaschutzbeiträge und die Messbarkeit von Anpassungsfortschritten.
Genau zehn Jahre nach Verabschiedung des Übereinkommens von Paris (ÜvP) findet vom 10. bis mindestens 21. November 2025 zum 30. Mal die Konferenz der Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention (Conference of the Parties – COP30) statt, diesmal im brasilianischen Belèm. Die diesjährige Konferenz steht im Zeichen des von der COP-Präsidentschaft ausgerufenen „Mutirão“, einem brasilianischen Konzept der gemeinschaftlichen und kollektiven Anstrengung, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Die Wahl des Austragungsortes der UN-Klimakonferenz am Tor zum Amazonasgebiets hat auch einen symbolischen Charakter: Der Amazonas ist weltweites Zentrum der Biodiversität, CO2-Senke und steht repräsentativ für die globale Ungleichheit, mit der die Klimakrise verschiedene Länder, Einkommens- und Bevölkerungsgruppen trifft. Allein im Amazonasgebiet leben mehrere Hundert indigene Völker, die besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, jedoch am wenigsten dazu beigetragen haben. Gleichzeitig sind diese Völker Wissensträger und Hüter der artenreichsten Gebiete der Welt. Themen wie Waldschutz, Biodiversitätsschutz und die Rolle indigener Gemeinschaften und Völker sollen als Eckpfeiler des Klimaschutzes auf der Konferenz stärker in den Fokus rücken.
Nachdem letztes Jahr auf der COP29 in Baku ein Beschluss für mehr Transparenz, Umweltintegrität und ökologische Nachhaltigkeit beim globalen Emissionshandel nach Artikel 6 des ÜvP getroffen wurde, können nun alle Mechanismen des Abkommens umgesetzt werden. In einem Brief an die internationale Gemeinschaft im Mai 2025 läutete COP30-Präsident André Aranha Correa do Lago nach vielen Jahren zäher Verhandlungen das Zeitalter der Umsetzung ein. Konkret wird es auf der COP30 darum gehen, verbindliche Vereinbarungen zu treffen, wie das Ziel des ÜvP, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, erreicht beziehungsweise in Reichweite gehalten werden kann.
Die neuen NDCs: Wegweiser für den Klimaschutz bis 2035
Eines der wichtigsten Instrumente für den globalen Klimaschutz sind die nationalen Klimaschutzbeiträge (Nationally Determined Contributions – NDCs), die nach dem ÜvP von allen Vertragsstaaten alle fünf Jahre neu vorgelegt werden sollen. Die neue Runde der NDCs ist dieses Jahr fällig. Ende Oktober veröffentlichte das UN-Klimasekretariat den NDC-Synthesebericht, der alle bis Ende September 2025 eingereichten NDCs zusammenfasst und analysiert. Das Ergebnis: Bis Ende September haben nur 64 Staaten (von 194 Vertragsstaaten des ÜvP plus der EU) ein neues NDC eingereicht, womit nur 30 Prozent der globalen Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) abgebildet werden. Die eingereichten NDCs sind ambitionierter als die vorherigen und auf die Ergebnisse der ersten globalen Bestandsaufnahme ausgerichtet.
Die Analyse zeigt aber auch eine immense Lücke auf: Bei vollständiger Umsetzung der NDCs würden die Emissionen dieser Länder bis 2035 um 17 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 sinken. Um auf einen mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatiblen Pfad zu kommen, sind aber laut des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarats (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) Reduktionen der THG-Emissionen bis 2035 von 60 Prozent gegenüber 2019 nötig. Die EU hat ihr NDC am 05.11.2025 eingereicht. Dieses sieht eine Reduktion der Treibhausgasemissionen von 66,25 bis 72,5 Prozent bis 2035 gegenüber 1990 vor. Von großer Bedeutung ist auch das chinesische NDC, das am 03.11.2025 eingereicht wurde, mit einem Ziel von 7 bis 10 Prozent Emissionsreduktion bis 2035 gegenüber dem Treibhausgasemissionshöchststand. Chinas Emissionen machen 30 Prozent des globalen Treibhausgasausstoßes aus. Die NDCs dienen als wichtige Grundlage für die Verhandlungen auf der COP30.
Laut dem Emissions Gap Report 2025 des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), der auch die von China und der EU bereits während des UN-Klimagipfels im September angekündigten NDCs einbezogen hat, würden die Emissionen bis 2035 bei vollständiger Umsetzung der NDCs um 15 Prozent gegenüber 2019 sinken, und zu einem Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert von 2,3 bis 2,5 °C führen. Mit aktuell umgesetzten Politiken steuert die Welt laut dem UNEP-Bericht auf eine Erwärmung von 2,8 °C bis zum Ende des Jahrhunderts zu. Vor Verabschiedung des ÜvP vor 10 Jahren steuerte die Welt noch auf einen Temperaturanstieg von knapp unter 4 °C zu.
Wichtige weitere Verhandlungsthemen der diesjährigen Weltklimakonferenz
- Klimafinanzierung – wie bezahlen wir den weltweiten Klimaschutz? Auf der Weltklimakonferenz 2024 haben sich die Vertragsstaaten auf ein neues Finanzierungsziel von 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr ab 2035 geeinigt, das für Klimaschutz und Anpassung in Entwicklungsländern bereitgestellt werden soll. Die gleichzeitig initiierte „Baku to Belèm Roadmap to 1.3 T“ mit der neuen Zielmarke von 1,3 Billionen US-Dollar pro Jahr von öffentlichen und privaten Quellen ab 2035 wurde von der COP29- und COP30-Präsidentschaft in Belèm kurz vor Start der COP30 vorgelegt. Der von der brasilianischen Präsidentschaft initiierte Circle of Finance Ministers hat wegweisende Empfehlungen hierzu gegeben. Dabei steht außer Frage, dass Klimaschutz wirtschaftliche Vorteile hat: Gut konzipierte Klimapolitiken führen laut einer OECD/UNDP-Studie sogar kurzfristig zu stärkerem Wirtschaftswachstum als Szenarien, die auf aktuellen Politiken basieren. Langfristig betrachtet lohnt sich ambitionierter Klimaschutz noch viel mehr: Selbst gemäß der eher konservativen Schätzungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und des United Nations Development Programme (UNDP) verhindern ambitioniertere Klimapläne signifikante klimawandelbedingte wirtschaftliche Verluste und sind notwendig, um langfristig Wohlstand zu sichern. Laut der Studie würden ambitionierte Klimapläne bis 2050 ein Plus von 3 Prozent und bis 2100 von 13 Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes bedeuten.
- Global Goal on Adaption – Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels wird immer wichtiger: Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Klimaanpassung, denn schon heute machen zunehmende Extremwetterereignisse wie Hitzewellen und Starkregen sowie daraus folgende Dürren und Überschwemmungen deutlich, dass reine Emissionsreduktion nicht mehr genügt. Besonders im Amazonasgebiet, wo indigene und ländliche Gemeinschaften von Entwaldung und Wetterextremen betroffen sind, soll die COP30 Wege aufzeigen, wie sich vulnerable Regionen widerstandsfähiger machen lassen. Ziel der Verhandlungen ist ein Abschluss des Arbeitsprogramms zu den Indikatoren zur Messung des Fortschritts bei Klimaanpassungsmaßnahmen.
- Arbeitsprogramm zum gerechten Übergang (Just Transition Work Program – JTWP): Ziel der Verhandlungen zum JTWP ist eine sozial gerechte Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Diese muss insbesondere die Bevölkerungsgruppen einbeziehen, die von der Transformation besonders betroffen sind. Die brasilianische COP-Präsidentschaft setzt hier einen expliziten Fokus. Laut der oben genannten OECD/UNDP-Studie könnten gezielte Investitionen in die Energiewende ergänzt durch Maßnahmen, die auf Ernährungssicherheit, Grundversorgung und Governance-Reformen abzielen, die Entwicklung in neun von zehn Ländern verbessern und haben das Potenzial, 175 Millionen Menschen aus extremer Armut zu holen. Dagegen trug die Verbrennung fossiler Brennstoffe im Jahr 2019 zu 4,2 Millionen vorzeitigen Todesfällen durch Luftverschmutzung bei, wobei 89 Prozent dieser Todesfälle in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auftraten.
- Gender Action Plan – für die Gleichstellung der Geschlechter: Ein weiteres Ziel der COP30 ist die Verabschiedung eines Gender-Aktionsplans zur Förderung langfristiger struktureller Verbesserung bei der Gleichstellung der Geschlechter in allen gesellschaftlichen Bereichen (Gender Mainstreaming), bei finanzpolitischen Instrumenten (Gender Budgeting) sowie der Bildung und wirtschaftlichen Stärkung von Frauen.
- Action Agenda – Von der Verhandlung zur Umsetzung: Ein wiederkehrendes Schlagwort der brasilianischen COP-Präsidentschaft lautet: „Delivery, not just diplomacy“. Gemeint ist, dass die COP30 in Belèm nicht nur mit Absichtserklärungen enden darf. Stattdessen sollen die Beschlüsse der globalen Bestandsaufnahme (GST) von der COP28 in Dubai durch konkrete Umsetzungspläne gestärkt werden sowie überprüfbare Mechanismen und neue Partnerschaften aus bestehenden Initiativen entstehen.
Zehn Jahre nach Paris: Jedes zehntel Grad zählt
Zehn Jahre nach Verabschiedung des ÜvP muss die internationale Gemeinschaft beweisen, dass sie ihre selbst gesteckten Ziele ernst meint. Jedes Zehntelgrad vermiedene Erwärmung ist entscheidend. Laut des neuen, jährlichen Klima-Zustandsberichts (The 2025 State of the Climate Report: a Planet on the Brink), liegen die größten Stellschrauben in der Transformation des Energiesektors hin zu Erneuerbaren, dem Schutz und der Wiederherstellung der Ökosysteme sowie der Reduktion von Lebensmittelabfällen und der Umstellung auf eine pflanzenreichere Ernährung. Zudem gibt es neben der Energiesicherheit erhebliche wirtschaftliche Vorteile von erneuerbaren Energien: 2024 waren 91 Prozent der neu in Betrieb genommenen Wind- und Solarprojekte günstiger als die günstigste verfügbare Alternative fossiler Brennstoffe.
Die COP30 könnte eine wichtige Wegmarke für die Umsetzung der globalen Klimaschutzziele werden. Der Austragungsort spielt dabei symbolisch eine wichtige Rolle: Der Amazonas wird nicht nur als „Lunge der Erde“ bezeichnet und ist durch Abholzung und die Auswirkungen des Klimawandels bedroht, sondern gilt auch als Brennpunkt globaler Ungleichheit. Klimapolitik ist kein abstraktes Rechenwerk, sondern eine Frage von Überleben und Gerechtigkeit. Klimaschutz bringt Vorteile für viele statt Profite für wenige, die sich mit diesen Profiten vor den fatalen Auswirkungen des Klimawandels schützen können, während die Ärmsten am stärksten unter den Folgen leiden.
Das Umweltbundesamt auf der Weltklimakonferenz
Das Umweltbundesamt (UBA) ist als Teil der deutschen Regierungsdelegation der COP30 an den Verhandlungen zu Klimaschutz (Globale Bestandsaufnahme, NDCs), Klimawissenschaft, Landwirtschaft, Emissionsberichterstattung sowie Klimabildung und Zusammenarbeit (Action for Climate Empowerment, ACE) beteiligt. Außerdem ist das UBA Mitorganisator von drei Veranstaltungen, die Sie per Livestream verfolgen können:
- 11.11.2025: COP30 Side Event "Harnessing Digital for Environmental Sustainability: Leveraging Common Action for a Sustainable Planet in the Digital Age" (Online-Veranstaltung)
- 13.11.2025: COP30 Side Event „Pathways towards Convergence – Recommendations from the Brazilian-German Track 1.5 Dialogue“ im Pavillon der brasilianischen Präsidentschaft zum deutsch-brasilianischen Klimadialog
- 17.11.2025: COP30 Side Event „Nature-Based Solutions and Beyond – Insights from the Sino-German Track-2-Dialogue“ im deutschen Klimapavillon der COP30
Associated content
Links
Verwandte Inhalte
Verwandte Publikationen
- Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und dem Übereinkommen von Paris 2025
- Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und dem Übereinkommen von Paris 2024
- Klimaorientierte Stadtentwicklung
- Inventarermittlung der F-Gase 2021/2022
- Kipppunkte und kaskadische Kippdynamiken im Klimasystem - Factsheet